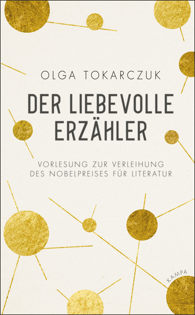Buchbesprechung
»Narrationen der Zukunft«
Olga Tokarczuk über das Weben von Geschichten
Welches Erlebnis hat Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk zum Erzählen gebracht? Warum zeugt die Ich-Erzählung von der Ratlosigkeit der heutigen Autoren? Wie verändern Serien die Art, wie erzählt wird, und was bedeutet das für die Narrationen der Zukunft? Tokarczuk nimmt den Leser in ihrer Rede zur Literaturnobelpreisverleihung mit auf eine Reise durch die Welt des Erzählens, dessen Wichtigkeit, Veränderung und Entwicklung, und sie beschreibt ihren Traum einer neuen Erzählart.
Neben der Rede ist auch das Essay »Wie Übersetzer die Welt retten« in dem Buch zu finden. Hier beschäftigt sich Tokarczuk mit der Bedeutung von Übersetzungen sowie mit Sprache und Literatur. Die letzten 32 Seiten des Buches bestehen aus einer chronologischen Abhandlung über Tokarczuks Erlebnisse und den Geschehnissen seit der Verkündung des Literaturnobelpreises bis zu dessen Verleihung. Es folgt eine biografische Notiz und Bibliografie.
In dem Essay »Der liebevolle Erzähler« steigt Tokarczuk mit einem Erlebnis aus ihrer Kindheit ein, das ihr die Grundlage für die Fähigkeit, zu erzählen, geschaffen haben soll. Mit einer bildhaften Nacherzählung dieses Moments leitet sie in eine Geschichte über das Erzählen ein. Der figurative Schreibstil zieht sich durch die gesamte Rede.
Sie äußert ihre Unzufriedenheit über die häufige Verwendung des »Ich-Erzählers« und das daraus folgende Stimmengewirr, das den Literaturmarkt überschwemme. »Was uns fehlt, ist – so scheint es – die parabolische Dimension der Erzählung.« (S. 20) Also Geschichten, die durch das Verwenden von Parabeln den Leser in einen »psychologisch anspruchsvollen Vorgang« (S. 21) zwingen und damit der Erfahrung beim Lesen eine Universalität verleihen. Es sei ihr wichtig, mehr als nur das Schicksal einer Einzelperson darzustellen. Dass die Menschen die engen Beziehungen zum Rest der Welt verloren haben, bedauert Tokarczuk stark: »Die Ich-Erzählung ist überaus bezeichnend für unseren gegenwärtigen Blick auf die Welt, bei dem der einzelne Mensch die Stellung eines subjektiven Mittelpunkts einnimmt.« (S. 17) Mithilfe einer neuen Erzählweise möchte sie die Beziehung zwischen Leser und Welt stärken. Tokarczuk möchte so erzählen, dass die Welt wieder zu einer lebendigen Einheit wird und der Leser seinen Platz in ihr versteht und sein Handeln überdenkt. Für sie bedeutet »der liebevolle Blick […], ein anderes Sein anzunehmen und aufzunehmen, in seiner Zerbrechlichkeit, seiner Einzigartigkeit, seiner Wehrlosigkeit gegen Leiden und das Wirken der Zeit.« (S. 60)
Der Streamingserie ordnet sie »eine neue Form des Welt-Erzählens« (S. 23) zu. Eine alte Erzählform würde hier mithilfe neuer Elemente zu einem großen Einfluss »auf die kollektiven Vorstellungswelten« (S. 24) werden. Die Art, mit der Serien den Zuschauer so lange wie möglich in ihrem Bann halten sollen, kritisiert sie zwar indirekt, aber hier werde tatsächlich an »den Narrationen der Zukunft gearbeitet« (S. 26) und es gäbe eine »Anpassung der Erzählweise an eine neue Realität« (S. 26). So sehr Tokarczuk auch von der Literatur überzeugt ist, kann sie sich jedoch vorstellen, dass »der Roman und die Literatur schlicht und einfach zu narrativen Randerscheinungen werden. Dass die bildhafte Darstellung, die neuen Formen direkter Erfahrungsvermittlung – Kino, Fotografie, Virtual Reality, Augmented Reality – eine wirkliche Alternative zum klassischen Lesen darstellen werden.« (S. 34)
Der Essay »Wie Übersetzer die Welt retten« schließt im Buch direkt an ihre Rede zur Nobelpreisverleihung an. Tokarczuk geht darin auf die Wichtigkeit der Übersetzer in Bezug auf die zivilisierte Welt ein. Ihr Argument eröffnet sie mit den arabischen Kalifen, die in ihrer Hauptstadt Bagdad eine Akademie für Übersetzungen gegründet hatten und dort Werke von Geographen, Astronomen, Medizinern und Astrologen gesammelt und übersetzt hatten. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches sind viele Originale zerstört worden, die Kopien in der Akademie jedoch sicher verwahrt gewesen. Das wiederholte sich im Mittelalter in Spanien mit der Reconquista – dem bewaffneten Kampf der Christen gegen die Mauren – und den Kreuzzügen. Nach der Eroberung arabischer Städte wurden die dort gefundenen Werke wieder ins Lateinische übersetzt. Dies stieß eine »Wende in der mittelalterlichen Wissenschaft und Philosophie« (S. 80) an. Durch die Übersetzungen aus dem Arabischen, das eine deutlich plastischere Sprache ist, entstand außerdem eine Vielzahl an neuen Begriffen, die der Westen zuvor nicht kannte. Dies zeigt die Qualität einer guten Übersetzung, meint Tokarczuk. Der Übersetzer leistet eine ungemeine »geistige Vorarbeit« (S. 84), indem er das Geschriebene bereits einmal verarbeitet, bevor er es in einer anderen Sprache wieder zu Papier bringt. Hiermit wird nicht nur Wissen gesichert, sondern auch vereinfacht und in modernerer Sprache wiedergegeben. Literatur beginnt für Tokarczuk immer mit dem Autor, denn mit dem Wiedergeben der eigenen Sprache macht dieser das Private öffentlich. Die private Sprache sieht Tokarczuk als etwas ganz Besonderes und Einzigartiges an. Kultur versteht sie als einen Akt des »Austarierens zwischen privaten und kollektiven Sprachen« (S.92). Übersetzer machen das Verstehen fremder Welten möglich.
Das Buch empfiehlt sich jedem, der in die Welt von Olga Tokarczuk eintauchen und einen Blick in ihre Art zu Denken werfen möchte. In ihrer Rede zur Literaturnobelpreisverleihung gibt sie kleine Denkanstöße, denen der Leser gut folgen kann. Durch die Klarheit ihrer Sprache flicht sie auch verständlich ihre Vorstellung eines neuen Erzählens ein.