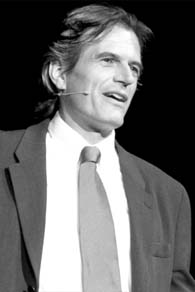(1) Fall NACHRICHTENBLOCK , Situationsanalyse
Die Textproduktionshandlungen vermessen
Während des Schreibens zeichnet die Progressionsanalyse jeden Arbeitsschritt auf, den jemand am Computer vollzieht. Dazu läuft hinter dem Textprogramm ein Aufzeichnungsprogramm. Das wissen die Schreibenden; anzunehmen ist, dass dieses Wissen sie am Anfang stärker irritiert, mit der Zeit weniger. Technisch bleibt der Aufzeichnungsprozess unsichtbar bis zur Auswertung.
Diese Auswertung geschieht zum Beispiel in S-Notation: Überall dort, wo jemand seinen Schreibfluss unterbricht, um etwas zu löschen oder einzufügen, setzt die S-Notation das Break-Zeichen | in den Text. Gelöschte Stellen, Deletionen, stehen in [eckigen Klammern]; nachträgliche Einfügungen, Insertionen, stehen in {geschweiften Klammern}. Insertionen und Deletionen bilden zusammen die Revisionen. Eine Revision ist also ein Schritt im Schreibprozess, bei dem eine sprachliche Einheit eingefügt oder gelöscht wird. Die Zahlen unten an den Break-Zeichen und oben an den Klammern zeigen die Reihenfolge der Schritte, der Revisionen, an (Beispiel 2):
Raum168{-}168 | 169 fahrt 169 {-} 169 | 170 kreisen. Glenn wurde berühmt, als er 172
[am 20. Februar ] 172 | 173 1962 als erster US-Astronaut 173 [mit der Raumkapsel
«Mercury Friendship-7‹ di] 173 | 174 174 {di} 174 | 175 e Erde umrundete.
(2) Fall NACHRICHTENBLOCK , S-Notation
Erkennbar wird in diesem leicht gefilterten Ausschnitt aus der S-Notation, dass MB in den Revisionen 168 und 169 das Wort »Raumfahrtkreisen« zu »Raumfahrtkreisen « aufbricht, dann in den Revisionen 172 und 173 »am 20. Februar« und »mit der Raumkapsel ›Mercury Friendship-7‹ di« löscht und schließlich in Revision 174 das zu viel gelöschte »di« von »die Erde« wieder einfügt. So verdeutlicht die S-Notation, Revision um Revision, wie ein Text entstanden ist.
Die großen Bewegungen der Textentstehung dagegen werden leichter erkennbar in der Progressionsgrafik. Jeder Punkt der Progressionsgrafik stellt eine Revision dar. Die x-Achse zeigt die Reihenfolge der Revisionen im Schreibprozess, die y-Achse zeigt die Reihenfolge der Revisionen im fertigen Textprodukt. So ist auf einen Blick erkennbar, wo jemand beim Schreiben hin und her gesprungen ist im entstehenden Text und wo er linear geschrieben hat, also von oben nach unten. Die Progressionsgrafik von MBs Textproduktionsprozess zeigt ein dreiphasiges Arbeiten mit Turbulenzen am Schluss (Abb. 1):
In einer ersten Phase (ganz links in der Grafik) kopiert MB die Quellentexte der Nachrichtenagentur in sein Schreibfenster; dabei legt er die Abfolge fest: Inland, Ausland, Sport. Zum ersten Thema kopiert er zwei Meldungen ins Fenster. In einer zweiten Phase (ab Revision 10) bearbeitet er die Reihe der bereits einkopierten Meldungen linear, von oben nach unten. In einer dritten Phase (ab 137) überblickt er den ganzen Nachrichtenblock, verdeutlicht die Gliederung mit Leerzeilen, schreibt eine Wettermeldung an den Schluss (ab 140) und kopiert eine zusätzliche Auslandmeldung ein, die er sogleich kürzt (ab 146).
Ein Verbalprotokoll erstellen
Nach dem Schreiben erschließt die Progressionsanalyse die Repertoires individueller Schreibstrategien: Ist der Schreibprozess abgeschlossen, können sich die Autorinnen und Autoren in Echtzeit oder im Zeitraffer anschauen, wie der Text am Bildschirm entstanden ist. Dabei sagen sie laufend, was sie beim Schreiben getan haben und warum sie es getan haben. Ein Tonaufnahmegerät zeichnet diese datengestützten retrospektiven Verbalprotokolle auf. So kommentiert MB zum Beispiel die Revisionen 168–174 (Beispiel 3):
Da sind die <Raumfahrtkreisen>, werden auch aufgeschlüsselt, und ich erkläre noch einmal wegen 1962- 20. Februar, dass es genau dort ist, nimmt mir wieder Platz und gibt sehr viel Informationen, die es sehr anstrengend machen zum Hören, deshalb kommen sie weg, ebenfalls, wie diese Raumkapsel heißt. Ist für die Zeitung sehr gut, aber für uns muss eine Meldung einfach gemacht sein.
(3) Fall NACHRICHTENBLOCK , Verbalprotokoll zu Revision 53
Bei solchen retrospektiven Verbalisierungen sind Verzerrungen auf mindestens drei Stufen zu erwarten: Erstens erfasst und speichert man seine eigenen Überlegungen und sein Handeln nur perspektivisch und gefiltert, zweitens rekonstruiert man sein Denken und Handeln beim Erinnern wiederum subjektiv, und drittens kann man bewusst mitsteuern, was man zur Sprache bringen will – etwa um gegenüber den Forschern in einem bestimmten Licht zu erscheinen. Bei der Datenaufzeichnung und -auswertung sind solche Verzerrungen stets mit zu bedenken (Pitts 1982; DiPardo 1994; Levy et al. 1996; Leander u. Prior 2004).
Auch wichtig ist, dass kein heute greifbares Verfahren zur Datenerhebung ein direktes Fenster in den Kopf öffnet. Bildgebende Verfahren zur Hirntätigkeit etwa würden die natürliche Textproduktion erheblich stören, ebenso die Methode des lauten Denkens, bei der Schreibende während der Tätigkeit kommentieren, was sie tun und warum sie es tun. Bei der retrospektiven Verbalisierung dagegen treten die Forschenden erst auf den Plan, wenn der natürliche Textproduktionsprozess abgeschlossen ist.
MBs retrospektives Verbalprotokoll ist also nicht zu lesen als eine originalgetreue Wiedergabe von Überlegungen, die der Autor während des Schreibprozesses tatsächlich so angestellt hat. Vielmehr bringt MB, angeregt durch die Beobachtung seines eigenen Schreibhandelns, einzelne Überlegungen zur Sprache, die er in vergleichbaren Situationen anstellen könnte: Überlegungen, die in seinem bewussten Wissen zur Sprache, zum Sprachgebrauch und besonders zur Textproduktion gründen. Zu diesen Überlegungen zählen die Schreibstrategien.