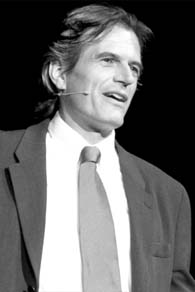Befunde: Regelhaftes in Repertoires erkennen
Unter einer Schreibstrategie verstehe ich die verfestigte, bewusste und damit benennbare Vorstellung davon, wie Entscheidungen beim Schreiben zu fällen sind, damit eine Schreibaufgabe optimal gelöst werden kann – damit also der Schreibprozess und das Textprodukt mit höherer Wahrscheinlichkeit eine zielgemäße Gestalt annehmen und eine zielgemäße Funktion erfüllen.
Solche Schreibstrategien zeigen das Format »x tun, weil y gilt« oder »x tun, um y zu erreichen«, wobei y ungenannt bleiben kann (Becker-Mrotzek u. Heino 1993; Ortner 2002; Perrin 2001, S. 18).
Mit der Äußerung »Sehe da etwas, […] das ist das Topthema der Woche, das kommt ganz bestimmt rein. Speichere es ab und nehme es direkt in meinen Text rüber« zum Beispiel benennt MB die Strategien »Einen Quellentext übernehmen, weil sein Thema Topthema der Woche ist« und »Einen Quellentext in die eigene Textdatei einkopieren, um ihn zu übernehmen«. So lässt sich aus MBs retrospektivem Verbalprotokoll das Repertoire der benannten Strategien ableiten, auf Bezüge von Textgestaltung und beabsichtigter Textwirkung hin analysieren und in Bezug setzen zu anderen Repertoires.
Das Repertoire der benannten Strategien
Die folgende Liste zeigt der Reihe nach alle Auszüge aus dem Verbalprotokoll, in denen MB Schreibstrategien zur Sprache bringt. Nach jedem Protokollauszug sind die formatierten Strategien aufgelistet, in Form von standardisierten Umschreibungen der Äußerungen im Protokoll. Dort, wo die Abfolge der Textproduktionshandlungen leicht nachvollziehbar ist, zeigen zudem Auszüge in S-Notation die Textrevisionen – also welche Textstellen MB in welcher Reihenfolge eingefügt und gelöscht hat (Tab. 1).
Strategien zu Textgestaltung und Textwirkung
MB bringt also ein breites Repertoire von Textproduktionsstrategien zur Sprache. Ein Teil der Strategien ist ausgerichtet auf die Gestaltung des Arbeitsprozesses (1b, 3a, 3b, 76a, 168a, 179b); die anderen auf die Gestaltung des Textprodukts. Diese produktgerichteten Strategien betreffen die Beziehung des Texts zu berichteten Weltausschnitten (121a), zu aktuellen Diskursen (1a), zu generellen Sprachnormen (179a, 140b, 168b), zum Medium Radio (15a, 121b, 168d, 58a) und zu den Adressaten (140a, 8a, 103b, 103a, 168c).
In jener letzten Gruppe benennt MB die Adressaten ausdrücklich, und zwar als »uns« (8a, 103a), »die Leute« (140a) und »die Hörer« (103b) beim »Hören« (168c). In MBs Vorstellung erwarten die Adressaten Serviceleistungen zum »Ski fahren« (140a) und »menschliche Nähe« (8a), sie wollen sich das Berichtete »vorstellen« können (103a) und sich beim Nachrichtenhören nicht anstrengen (168c) – und sie drohen ihre »Aufmerksamkeit« abzuwenden, wenn Äußerungen nicht »verständlich formuliert« sind (103b).
Eine ähnlich breite Gruppe von Strategien zielt auf mediengerechte, hier radiogerechte Beitragsgestaltung. Dazu gehören relative statt absolute Zeitangaben (15a), einfache statt »komplizierte« und deshalb »doof« klingende Formulierungen (121b). Zu vermeiden sind komplizierte Details (168d) und Wortwiederholungen (58a). Zweimal gibt MB zu verstehen, er müsse seinen Quellentext redigieren, weil die Nachrichtenagentur für die Zeitung geschrieben habe, nicht fürs Radio (15a, 168d).
Mit den übrigen produktgerichteten Strategien zielt MB darauf, allgemeine Normen journalistischer Kommunikation einzuhalten. Er will aktuelle Themen aufgreifen (1a), die vorgegebene Beitragslänge einhalten (140b und 168b) sowie falsche Aussagen, sprachliche Fehler und »schlechte Formulierungen« vermeiden (121a, 179a). Seine prozessgerichteten Strategien schließlich betreffen die Materialsammlung (1b, 3a, 3b), die Textüberarbeitung (76a), die Textkontrolle (179b) und die Vorbereitung des Typoskripts zum Sprechen (168a).
Zusammengefasst zeigt die Progressionsanalyse im Fall Nachrichtenblock, dass der Journalist MB mit Blick auf seine Textrevisionen bestimmte produktionsleitende Vorstellungen zum Zusammenhang von Textgestaltung und beabsichtigter Textwirkung zur Sprache bringt. Deutlich zeichnet er dabei seine Vorstellung der Adressaten und des Mediums Radio. In beiden Bezugsrahmen zielt er auf anschaulich, verständlich und unkompliziert gestaltete Texte.