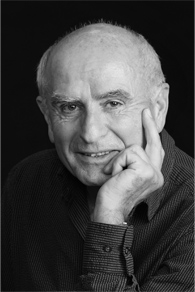Schon die Antike war sich also des Doppelwesens der Erinnerung bewußt, erkannte Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. (Nietzsche, dem Kenner der antiken Philosophie und Rhetorik, waren diese Ideen natürlich vertraut.) Erinnerung kann zur Last werden, wenn sie unterschiedslos alles sammelt, was ihr begegnet, unabhängig davon, ob das, was erinnert wird, auch wirklich wert ist, aufbewahrt zu werden. Die retrospektive Ausrichtung des Gedächtnisses und der Historie ist unter dem Einfluss Platons in Europa ziemlich beherrschend geworden, bis jener Neapolitaner die rhetorische Gegenrichtung wiederentdeckte. Ihm ist es zu verdanken, dass die »welterinnernde memoria und die weltschöpferische phantasia« erneut zum Bund zusammenfanden; wie wir wissen, mit gewaltigen Folgen.
Ich will mich nun nicht etwa in deren labyrinthische Weiten verlieren, aber doch zum Schluß noch einige Kreuzpunkte andeuten. Vico blieb zu seiner Zeit ziemlich wirkungslos. Erst Hegel entdeckte die fruchtbare Kehre, deutete das Prinzip der modernen Welt als Anfangs- und Voraussetzungslosigkeit und setzte ihm seine dialektische Auffassung von Geschichte entgegen. Danach bewegt sie sich ständig fort, in jeder neuen Stufe hebt sie das überlieferte Abbild des Vergangenen auf, bewahrt es damit einerseits, überschreitet im selben Akt aber seine Grenzen und tritt in veränderter Gestalt hervor. Es ist für uns nicht mehr schwierig, in diesem Geschichtsverständnis die Phasen des rhetorischen Produktionsprozesses und die Spuren der schöpferischen imitatio wiederzufinden, von welchen ich gesprochen habe. Darin ist doch auch ein sehr modernes Verhältnis zur Zeit mitbedeutet: die Nachahmung hatte sich, dank ihres Praxisbezugs, auf diejenigen Züge des überlieferten Modells zu richten, die das Voraus, das Zukünftige und das ihnen gegenüber Neue schon immer mitmeinen. In der 14. seiner aus Hegels Geist formulierten geschichtsphilosophischen Thesen hat Walter Benjamin den Zukunftsbezug des Vergangenen, dem dialektisch der Vergangenheitsbezug des Gegenwärtigen entspricht, mit einem uns vertrauten Beispiel pointiert: »Die Geschichte«, schreibt er, »ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von ›Jetztzeit‹ erfüllte bildet. So war für Robespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Die Französische Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom.«
Wenn wir uns im Lichte solcher Gedanken den Zustand der aktuellen Literatur und Beredsamkeit vergegenwärtigen, sieht man die Folgen einer geschichtsvergessen auf die ewige Gegenwart fixierten Praxis. Ob aus Überdruss oder Unkenntnis, aus Bildungsnot oder hybrider Absicht verzichten ihre Autoren auf Orientierung und Wettstreit mit den Mustern, den Vorbildern und Idealen, die doch Führung und Antizipation zugleich bieten. Nachahmung ist aber – recht und das heißt ihrem historischen Ursprung und praktischen Wesen nach verstanden –: produktive Erinnerung, in ihr sind Wiederaufnahme und Originalität aufs engste verbunden, und Abbilden geht über in Fortbilden.
Lassen Sie mich mit dem Mahnruf eines modernen, selber höchst imitatio-tüchtigen Autors schließen, nämlich mit den Worten Hermann Brochs, die am Ende seines großen Zeitromans »Die Schlafwandler« stehen: »… im Aufstand des Irrationalen, auslöschend das Ich und seine Grenzen durchbrechend, Zeit und Entfernung aufhebend, im Orkan des Eisigen, im Sturme des Hineinstürzens … tönt die Stimme, die das Gewesene mit allem Künftigen verbindet und die Einsamkeit mit allen Einsamkeiten, und es ist nicht die Stimme der Furchtbarkeit und des Gerichts, zaghaft tönt sie im Schweigen des Logos, dennoch von ihm getragen, emporgehoben über den Lärm des Nichtexistenten, es ist die Stimme des Menschen und der Völker, die Stimme des Trostes und der Hoffnung und der unmittelbaren Güte: ›Tu dir kein Leid! Denn wir sind alle noch hier!‹«
»Wir sind alle noch hier!«