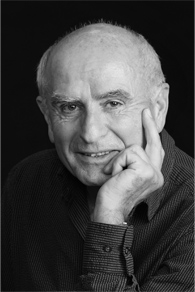Als vollends fruchtbar erwies sich der so eingeleitete Paradigmenwechsel nach dem Ende der Tyrannis, als nun gänzlich neue, nämlich demokratische Formen der politischen Herrschaft sich durchsetzten, die ohne unmittelbares Vorbild waren, sich auf die Vergangenheit nur in Fragen der Sozialtechnik und der institutionellen Organisation von Herrschaft beziehen oder durch Rückgriff auf sehr alte, ursprüngliche Verhältnisse wie in den mythologischen Kulturentstehungstheorien Legitimationskraft erwerben konnten. In Volksversammlung und Volksgericht verfing also der unmittelbare Rekurs auf das Hergebrachte nicht mehr, wenn es darum ging, Entscheidungen hier und jetzt zu begründen – er hätte im Gegenteil jeden Versuch in Mißkredit gebracht. Daraus erwuchs eine Schwierigkeit. Das wichtigste Instrument, um in den neuen Institutionen durchsetzungskräftige Urteile und damit Handlungsoptionen zu gewinnen, war die rednerische Auseinandersetzung geworden, die in früheren Epochen Usus einer kleinen Elite gewesen war und nun jedem Bürger zur Verfügung stehen sollte. Mit dem Ziel: über den Consensus politische Herrschaft zu organisieren. Dabei hatte sich nun ein merkwürdiger Umstand herausgestellt, den Aristoteles am Anfang seiner Rhetorik fast beiläufig erwähnt: daß nämlich einige Redner ziemlich regelmäßig erfolgreich agierten, andere gleichfalls regelmäßig Mißerfolge einstecken mußten, während eine dritte Gruppe hin und wieder Einzelerfolge verbuchen konnte.
Die Frage nach den Ursachen lag nahe, man untersuchte die Reden der erfolgreichen Redner nach den Bedingungen ihres Gelingens, gewann Methoden und Techniken, die das zufällige zu einem sicheren Können machten, weil sie gelehrt und gelernt werden konnten. Ein gewaltiger Fortschritt. Die ersten Lehrbücher überhaupt in der europäischen Geschichte waren Sammlungen von Musterreden, die sich nach Inhalt, Struktur und sprachlicher Machart zum Vorbild typischer Redesituationen eigneten. Als Vorbild freilich, das man nicht etwa eins zu eins übernehmen konnte, die Glaubwürdigkeit des Musterstücks hätte bei bloßer Wiederholung schnell gelitten. Es kam also auf die maßgebende Situation an, ihren Erfordernissen musste das Ideal angepasst werden, damit es seine Glaubwürdigkeit nicht verlor.
Doch warum erzähle ich Ihnen diese alte und vielen gewiß nicht unbekannte Geschichte, zudem noch in gebotener Kürze und idealtypischer Vereinfachung? Weil aus dem politischen und ideologischen Machtverlust der überwundenen alten Welt das Bedürfnis nach neuen Instrumenten der Daseinssicherung und des staatlichen Handelns folgte. Das aber veränderte notwendigerweise den Umgang mit der Überlieferung, sie fungierte nicht als Zwangssystem, sondern als Reservoir von Modellen, die geprüft, den neuen Verhältnissen gemäß geändert und in ihrer Überzeugungskraft erneuert werden mußten. Die rhetorische und alsbald für geistige Produktionen universal geltende Kategorie, die den komplexen Sachverhalt benannte, hieß in Athen »mimesis«, in Rom »imitatio«. Sie war, wenn man sich Ursprung und Aufgabe vergegenwärtigt, in sich widersprüchlicher, vor allem komplexer, als es spätere Verfallsformen den Nachgeborenen suggerieren und deren meist eindimensionale Kritik inspirieren sollten. Quinitilian, Ciceronianer durch und durch, erster vom Staat bezahlter Präzeptor, Vater der europäischen Pädagogik und Autor des bedeutensten Lehrwerks der Rhetorik, fängt ganz allgemein an, wenn er die Bedeutung der imitatio erläutert: »Unser Leben zeigt ja überall den Grundsatz, daß wir das, was wir bei anderen gut finden, auch selbst tun wollen. So richten sich die Knaben nach den Führungslinien der Buchstaben, um Schreiberfahrung zu gewinnen, so richten die Musiker auf die Stimme der Lehrer, die Maler auf die Werke ihrer Vorgänger, die Landwirte auf den Anbau, der durch Erfahrung erprobt ist, als Vorbild ihr Augenmerk; kurz wir sehen, daß die Anfangsgründe [!] in jedem Lehrfach ihre feste Form in einer Vorschrift finden, die ihnen schon vorliegt.« Doch dann fügt er sogleich hinzu: »Aber gerade die Tatsache, daß die Nachahmung die Ausführung aller Aufgaben so viel leichter macht, als sie für die war, die nichts hatten, wonach sie sich richten konnten, kann Schaden stiften, wenn man hierbei nicht behutsam und mit eigenem Urteil vorgeht.«
Wir wissen nun schon, was mit solcher Warnung gemeint ist. Die anthropologische Ansicht, die hinter Quintilians so pragmatisch klingenden Bemerkungen steht, hat die Virulenz des Imitatio-Konzepts bis heute, bis zu dieser Tagung hin, garantiert. Daß der Mensch nämlich ein »von der Natur im Stich gelassenes Mängelwesen« ist, so Hans Blumenberg. Nachahmung ersetzt ihm die fehlenden Instinktreserven und sicheren Einpassungsstrukturen. Ihre in der Praxis paradoxe Struktur hat Francis Bacon in die von ihm irrtümlicherweise antirhetorisch gemeinte Formel gefasst: »natura parendo vincitur«, die Natur wird durch Gehorchen besiegt. Oder eben: Durch Nachahmen gewinnt man das Neue.
Machen wir es uns noch einmal klar: Nachfolgen und Überschreiten sind dieser Doktrin folgend nicht Gegensätze, sondern hängen eng zusammen. Das Muster, das ich nachahme, stammt zwar aus vergangenen Praxisverhältnissen, doch die darin enthaltenen Qualitäten der Gelungenheit machen es tauglich, um in neuer Situation sich bewähren zu können, sofern sie angemessen berücksichtigt wird. Derart wird das Vorbild zum Gegenstand rhetorischer Phantasie und das bereits im Unterricht. Der Schüler studierte die Musterreden, die oft, wie im Falle auch von Isokrates oder Quintilian, der Lehrer für diesen Zweck und seinerseits Vorbildern folgend geschrieben hatte. Ihre Kopie war nicht beabsichtigt. In ihrer Manier hatte der Adept historische Themen, wirkliche Prozesse oder erfundene Fälle zu bearbeiten. »Was soll Agamemnon tun, nachdem ihm der Seher Kalchas erklärt hat, nur die Opferung Iphigenies, der eigenen Tochter, vermöge Artemis dazu zu bringen, der griechischen Flotte ihre Überfahrt nach Troja zu gestatten? Soll sich Cicero bittflehend an seinen Todfeind Antonius wenden, um sein Leben zu retten? Soll er sich bereit finden, seine Schriften zu vernichten, wenn Antonius ihm unter dieser Bedingung Schonung verspricht?«