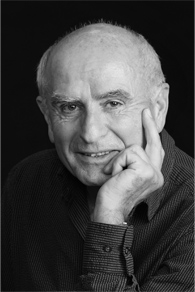Der Schüler hatte Pro und Contra, Ankläger und Verteidiger wechselweise zu vertreten. Manfred Fuhrmann berichtet uns von diesem Schulbetrieb, der oft in der Routine der immer gleichen Exempel erstickte, aber auch Fähigkeiten zur Variation, neue Argumente zu finden und in alten Stoffen überraschende Beispiele zu entdecken, förderte. Gelegentlich schlug dabei die imitatio, ins Extrem getrieben, in phantastische Originalität um: »Man ließ dort (in den konstruierten Fällen) vorzugsweise Randexistenzen der menschlichen Gesellschaft, etwa Räuber, Dirnen oder Tyrannen, auftreten, man sorgte für pikante Situationen und grelle Kontraste, man schrieb für die rechtliche Würdigung Gesetze vor, die es nie gegeben hatte und nie geben konnte – kurz, die Rhetorenschule brachte in ihren Übungsreden eine Phantasiewelt hervor, die möglichst krass von der Alltagswirklichkeit abstach.« Nachahmung schlägt in diesen von Fuhrmann gemeinten Fällen in geradezu surrealistische Überbietung um.
Vor Gericht oder in der Volksversammlung fand das imitatio-Prinzip natürlich andere Anwendung: Die Nachahmung funktionierte als Mittel agonaler Auseinandersetzung und hatte deren Grenzen nicht zu überschreiten. Zuerst galt es, die Verfahrensweise des Gegners zu kennen, um sie benutzen und gegen ihn kehren zu können; seit Protagoras eine grundlegende rhetorische Strategie, zu der auch die grotesk verzerrende Imitation des gegnerischen Vorbilds bis hin zum ironischen Zitat oder zur lächerlichen Konsequenz gehört. Ein agonales Motiv steckt hinter solch überbietendem Imitieren, eine eigene Kategorie erhebt es in den Rang der Regel: die aemulatio. Die bedeutendsten Theoretiker haben darin Sinn und Ziel des Nachahmens gesehen:
»Schimpflich ist es geradezu, sich damit zu begnügen, nur das zu erreichen, was man nachmacht. Denn noch einmal: was wäre geschehen, wenn niemand mehr zustande gebracht hätte als sein Vorgänger? Nichts hätten wir in der Dichtung über Livius Andronicus hinaus, nichts in der Geschichtsschreibung über die Priesterjahrbücher hinaus, auf Flößen ginge noch die Schiffahrt vonstatten. Es gäbe keine Malerei außer der, die nur die Schattenumrisse nachzeichnete, die die Körper in der Sonne warfen. Und so kann man es durchgehen, was man will: keine Kunst ist in dem Zustand geblieben, wie sie bei ihrer Erfindung war, keine gleich am Anfang stehen geblieben – es sei denn, wir verdammen nur gerade unsere eigenen Zeiten dazu, so unfruchtbar zu sein, daß gerade heutzutage nichts mehr wächst, wo man nur nachahmt.« So Quintilian, der antike Theoretiker, der wohl am gründlichsten das paradoxe Wesen der Nachahmung bedacht hat. Schon im Terminus selber steckt dessen Verpflichtung zur Ähnlichkeit, nicht etwa zur Identität mit der Vorlage.
Spätere Zeiten haben des ungeachtet die Rhetorik auf ein starres Regelsystem, auf eine Art Maschine festlegen wollen, die nur konventionelle Texte hervorbringt, individuelle Impulse unterdrückt und durch starres Festhalten am Hergebrachten entwicklungs- und geschichtsfeindlich ist. Keines dieser auch heute nicht verschwundenen Vorurteile hält der kritischen Nachprüfung stand. Die jeweils aktuelle problematische Handlungswirklichkeit, das Praxisfeld der Rhetorik, verlangt situativ angemessenes, flexibles, sensibel reagierendes Verhalten – bei Strafe des Untergangs, jedenfalls im Extremfalle. Nicht die Kopierpraxis steht daher im Zentrum der Theorie, sondern diejenigen Techniken, die den Tendenzinhalt des Vorbilds auf die vorliegenden Aufgaben hin weiterentwickeln – d. h. Techniken, die auf Veränderungen und Optimierung in einem wandelbaren, stets neuen Kontext zielen.
Ihr schöpferischer Gebrauch verlangt das »ingenium« des Autors, das zwar unter den Menschen ungleich verteilt ist, aber durch Kunst, durch »ars« und »exercitatio« vervollkommnet werden kann. Auf »Novitas«, Neuheit, geht die Arbeit; was das heißt, möchte ich an einem Beispiel, dem der sogenannten vier Änderungskategorien verdeutlichen. In den schematisch verkürzten Rhetorik-Lehrbüchern werden sie oft nur in der Abteilung »Stil-Lehre« behandelt, die auch einen Katalog von Änderungsmöglichkeiten im Vergleich mit der Alltagsrede beinhaltet.
Das erste Verfahren leitet das Hinzufügen von Gesichtspunkten, Stoffen und Argumenten an, die im Muster unberücksichtigt blieben und aus dem Problemfeld im Lichte neuer Erfahrungen gewonnen werden. Das kann, wie die folgenden Techniken auch, auf der Ebene der »res« (der Sachen, des Inhalts) oder der »verba« , also der Sprache, oder drittens auf beiden zugleich geschehen. Welch letzteres der Normalfall ist, da die Wahl des einen Schwerpunktes immer Auswirkungen auf den anderen hat.
Die zweite Technik verfolgt das Gegenteil der ersten, sie eliminiert unpassende, störende, nicht mehr überzeugungskräftige Bestandteile aus dem Kontext der überlieferten Materie. Beide Techniken lassen sich verfeinern, etwa nach Umfang und Art der Hinzufügung oder Wegnahme, oder auch topologisch nach dem Ort des verändernden Eingriffs im Ganzen der Vorlage – doch möchte ich mich nicht allzusehr in Einzelheiten vertiefen.