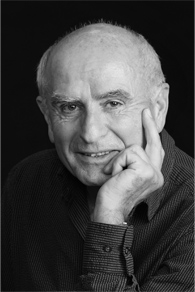Ich möchte nun heute aus dem protagoreischen Modell etwas andere Konsequenzen ziehen. Sie setzen bei den beiden Sendungen an, die Hermes in Zeus’ Auftrag den Menschen brachte, und konzentrieren sich dabei auf die schwerer Fassbare von den beiden, auf Aidós. Denn während Inhalt und Wirksamkeit Díkes keine Rätsel aufgibt, ist die Forschung über die Bedeutung von Aidós bis heute zu keinem einheitlichen Ergebnis gelangt. Díke ist mythologisch die göttliche Gerechtigkeit, von ihr gehen Gehalt und Sprache des griechischen Rechtsdenkens aus, sie ist also Sache des Logos, auch wenn ihre Praxis darin natürlich nicht gänzlich aufgeht. Aidós aber, ich habe schon daraufhingewiesen, steht für einen »gewaltige(n) Begriffsumfang«, wie das »Historische Wörterbuch der Philosophie« urteilt. Ein Umfang, in dem aber, meine ich, der rhetorische Blick Klarheit zu schaffen vermag. Denn welche Bedeutung oder Nuance man immer ins Treffen führt (ob Ehrfurcht oder Respekt, Verehrung oder Bewunderung, Mitleid oder Freundlichkeit, Entrüstung oder Scham, um nur wenige zu nennen) – es handelt sich immer um eine affektische Disposition. Ganz offensichtlich fasste Protagoras damit die sozialen Bindekräfte des Gefühls in ihrer ganzen Vielheit zusammen, die er für die Gründung und Stabilität menschlicher, staatlicher Gemeinschaft für ebenso wichtig hielt, wie das rechtliche Denken. In seinem Mythos läßt er Hermes des Allvater Zeus fragen, wie er Díke und Aidós unter die Menschen verteilen soll, ausgewählt wie Künste oder Gewerbe, »oder soll ich sie allen geben?« – »Allen, erwiderte Zeus, alle sollen daran Anteil haben, denn sonst könnte kein Gemeinwesen entstehen …«
Wenn wir nun die mythologische Einkleidung als das nehmen, was sie bei einem Denker wie Protagoras nur sein kann, der jede Aussage über die Götter als bloße Spekulation ablehnte, wenn wir in ihr also eine reine Gleichnisrede sehen, stellen wir überrascht fest, dass am Beginn anthropologischen Denkens schon die natürlichen Konstanten des Menschseins im Zusammenhang mit ihren Kulturformen, den Formen gemeinschaftlichen Zusammenlebens gedacht werden. Logos und Pathos (die Griechen kannten keinen anderen Ausdruck für die Affekte als Pathos) stehen als natürliche Bedingungen hinter Díke und Aidós, die ihrerseits deren historisch und kulturell bedeutendste Ausprägungen formulieren.
Ein weiterer für uns wichtiger Gesichtspunkt zeigt sich darin, dass hier ein erfahrener Redner seine empirisch gewonnenen Erkenntnisse im Gleichnis verdichtet und verdeutlicht, sich also dabei naturgemäß auf Lebenserfahrung und Menschenkenntnis bezieht. Anthropologische und rhetorische Perspektive überblenden sich, in beiden dominiert das Interesse am ganzen Menschen: einerseits was das Wissen um den spezifisch menschlichen Zustand betrifft, andererseits was die rhetorischen Konsequenzen angeht, die sich daraus ergeben. Beide haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt: das gelingende Leben in der Polis, das verfehlt wird, wenn die Schule politischer Tugend und praktischer Bürgerlichkeit, als die Protagoras die Rhetorik aufgefasst wissen wollte, sich nicht ihrer anthropologischen Grundlagen in aller Breite bewusst bleibt.
Um noch ein letztes Mal auf Protagoras’ urgeschichtliche Erzählung zu sprechen zu kommen, so zeugt es von der Klarheit des Sophisten, dass er für die affektische Seite des menschlichen Gemeinschaftswesens eine so unklare, nämlich vieldeutige Bezeichnung wählte, denn er verfiel damit nicht in den Fehler, den Nietzsche einmal denunzierte, das heißt »die Affekte uns (…) denkbar (zu) machen, d. h. sie (zu) leugnen und als Irrtümer des Intellekts (zu) behandeln.« Dass genau dieses geschehen würde, hat der Autor des Homo-mensura-Satzes freilich auch durch seine schöpferische Unklarheit nicht verhindern können. Wobei ich aber gleich hinzu setzen möchte, dass auch er sich jeder Gefühlsschwärmerei enthielt, wenn er auf der Fülle der Gefühle beharrte.
Wir brauchen nicht lange zu raten, wer die entscheidende Umkehr im Wertespektrum anthropologischer Grundannahmen markierte. Es war Platon, der mit seinem »pädagogischen Intellektualismus« (Bloch) die Affekte zwar als mächtige, aber eben deshalb auch energisch zu bekämpfende Störenfriede in seinem Konzept bürgerlicher Bildung behandelte. Die »größten Köder des Übels« nannte er sie, die »Vertreiber des Guten« oder »unüberlegte Ratgeber« – kurz gesagt: Ihm galten sie als Widersacher menschlicher Vervollkommnung und Zufriedenheit. Wollte man wirklich die Geschichte der Philosophie als bloße Sammlung von Fußnoten zum großen Platon betrachten, wie ein etwas törichtes Diktum Alfred Whiteheads es vorschlägt, so hätte man in Bezug auf die philosophische Affektdoktrin fast einen überzeugenden Beleg. Von der Stoa über die mittelalterliche Sündenlehre bis ins 19. Jahrhundert wirkte offenbar der platonische Bann. Affekte blieben die Krankheiten der Seele, sie haben der Vernunft zu gehorchen, sind direkter Ausfluss der Ursünde. Widervernünftig erscheinen sie auch Immanuel Kant, er vergleicht sie mit der »Schwindsucht« und dem »Wahnsinn«, sieht ein »qualifiziert Böses« in ihnen wirken. Selbst für Hegel, in dessen Dialektik der Geist der Verneinung eine so durchdringend bewegende Rolle spielt und das Zittern in Todesangst für die Herr-Knecht-Beziehung von so grundlegend verändernder Bedeutung ist, selbst für diesen Hegel sind die Leidenschaften nur als »List der Vernunft gerechtfertigt, die sie »für sich wirken läßt«.
Das ist gewiss eine sehr vereinfachende Verdichtung der philosophischen Abenteuer des Affekts, doch gibt sie die Richtung seines Fahrplanes ziemlich korrekt wieder. Zwei Stationen darin habe ich aber bisher – Sie werden es natürlich gemerkt haben – ausgelassen: Aristoteles in den Anfängen und Nietzsche zwar nicht am Ende, aber doch an einer späten und wegweisenden Station.