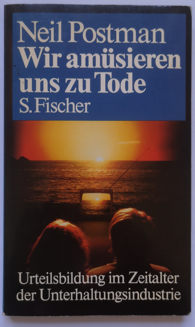Buchbesprechung
Unterhaltungsindustrie contra Schriftkultur
Über Neil Postmans Klassiker »Wir amüsieren uns zu Tode«
Als der Medienwissenschaftler Neil Postman 1985 mit »Wir amüsieren uns zu Tode« seine Kritik an der Unterhaltungsindustrie verfasste, war das Fernsehen in Amerika auf dem Höhepunkt seiner Wirkungskraft. Postman machte es sich zur Aufgabe, die tiefgreifenden Veränderungen, die dieses Medium auf unsere Eindrücke auf die Welt und Kommunikation hat, genauer zu untersuchen. Da es ihm um »Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie«, so der Untertitel, ging, lohnt es sich, den Band erneut zu lesen.
In seinem Buch diagnostiziert er den enormen Werteverfall, der mit der steigenden Vergnügungssucht der Menschheit einhergeht. Postman stützt die Voraussage, die Huxley in seinem Buch »Schöne neue Welt« bereits traf: Nicht die Demokratie werde zusammenbrechen, sondern die Menschheit werde an der tyrannischen Allgegenwärtigkeit des Vergnügens zu Grunde gehen. (vgl. S. 8) Gerade das Fernsehen verändere den Blick auf die Welt. Im Vergleich zu einem gedruckten Buch, das laut Postman Informationen sinnvoll und rational zusammenfasse, sei das Fernsehen gekennzeichnet durch Zusammenhanglosigkeit, fehlender Komplexität und Geschichtslosigkeit. (vgl. S. 36) Jedes Thema, sei es Religion, Bildung oder gar Politik, würde zum Entertainment. Damit ginge auch ein Rückschritt der intellektuellen Ausdrucksform einher. Um den Auswirkungen, die ein blindes Verfolgen dieser Neuerung nach sich ziehen, entgegenzuwirken, rät er dazu, ein kritisches Medienbewusstsein zu entwickeln: »Der Leser muss sich mit intellektueller Wachsamkeit wappnen.« (S. 67)
»Wir amüsieren uns zu Tode« ist in zwei Teile gegliedert. Der erste beschäftigt sich vor allem mit Grundlagen der Medientheorie Postmans, den Kennzeichen der amerikanischen Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert und den technischen und medialen Voraussetzungen des Fernsehzeitalters. Im zweiten Teil erläutert er vor allem an konkreten Beispielen (Fernsehnachrichten, Fernsehpredigten, Werbespots etc.) die Auswirkungen des Fernsehens auf Diskurse und Kommunikation. Die einzelnen Kapitel sind nicht voneinander abhängig. Jedes kann für sich gelesen werden und setzt kaum Kenntnisse der vorangegangenen Kapitel voraus. Wenn man sich von den ersten beiden Kapiteln nicht abschrecken lässt, die gewisse Grundkenntnisse der Medientheorie voraussetzen, gelangt man anschließend zum eigentlichen und gut nachvollziehbaren Hauptteil über das Buchdruckzeitalter hin zur Kritik am Fernsehen und seinen Auswirkungen. Postman erläutert unter anderem die mit der Erfindung des Telegrafen einhergehende Verkürzung der Informationen. Es entstand so eine Kultur zusammenhangloser Schlagzeilen, die sich auch auf die Sprache auswirkte (vgl. S. 124). »Unsere Sprache sind unsere Medien. Unsere Medien sind unsere Metaphern. Unsere Metaphern schaffen den Inhalt unserer Kultur.« (S. 25) Er sieht Fernsehen nicht als Erweiterung der Schriftkultur. Beides stehe im Gegensatz zueinander, da sich beim Fernsehen die Information der Unterhaltung unterordnen müsse (vgl. S. 62).
Postman zeigt, wie sich Medien auf die Gesellschaft und die Kultur auswirken und ausgewirkt haben. Das Werk könnte demnach auch als eine Studie zur Mediengeschichte gesehen werden, die untersucht, wie sich unterschiedliche Medien gegen andere durchgesetzt haben und wie sie sich auf die Gesellschaft auswirken. Sein Anliegen ist es, die Welt über die negativen Folgen des Fernsehens aufzuklären und das Medienbewusstsein zu schärfen, indem die Medien zum Thema in der Bildung, vor allem in den Schulen, gemacht werden. Daneben kritisiert er scharf, dass vom Fernsehen geprägte Kommunikations- und Lehrformen auch auf die Schulen übergreifen. »Problematisch am Fernsehen ist nicht, dass es uns unterhaltsame Themen präsentiert, problematisch ist, dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert.« (S. 110) Auch würden aus Politikern Popstars, die in kurzen Werbespots emotionale vereinfachte Botschaften verbreiten, anstatt komplexe Lösungen vorzustellen.
Natürlich wäre es weltfremd zu verlangen, das Fernsehen abzuschaffen. Jedoch sollte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Auswirkungen dieses Medium auf unser Leben und unsere Kommunikation hat. Mittlerweile erscheint das Medium »Fernsehen« fast passé. Das Internet, die »sozialen Medien« und Streaming-Plattformen lösen es ab. Das Smartphone ist der ständige Begleiter und somit auch der bewährte Schutz vor Langweile. Postman und Huxley, auf den Postman sich im ersten Teil seines Buches bezieht, haben in ihren Werken mit erschreckender Voraussicht unsere aktuelle Wirklichkeit beschrieben.